27.01.2020 | Fachpolitik, Im Landtag, Kleine Anfragen
Beim Studium der Einzelpläne bin ich kürzlich über einen erstaunlichen Einnahmetitel gestolpert. Im Einzelplan 13 – Allgemeine Finanzverwaltung – findet sich unter dem schönen Titel “Zuweisungen für Investitionen von der BvS – PMO” eine Einnahme von 36 Millionen Euro im Jahr 2020.
Nun muss man erst mal verstehen, was BvS und PMO bedeutet, bevor man erahnen kann, woher die 36 Millionen kommen, wofür sie eingesetzt werden können und warum ich so erstaunt über diese Summe bin. Daher hier ein kleiner Exkurs in die Finanzgeschichte der DDR und der ostdeutschen Länder.
Nach dem II. Weltkrieg gründeten sich in der DDR politische Parteien und Massenorganisationen (FDGB, FDJ etc.), diese eigneten sich im Verlauf des Bestehens der DDR Vermögen in Form Immobilien, Eigenbetrieben, Kunstwerken, Auslandskonten und Unternehmen im Ausland an.
Im Zuge der Wende begann der Streit um den weiteren Bestand und den Umgang mit diesen Vermögenswerten und Organisationen. Noch vor der deutschen Wiedervereinigung wurde von der Volkskammer ein Gesetz verabschiedet, das die Vermögen von Parteien und Massenorganisationen der DDR (PMO) unter die Verwaltung einer Behörde stellte.
 Im Jahr 1990 ging das bestehende PMO-Vermögen zur Prüfung und treuhänderischen Verwaltung in die Hände der Unabhängigen Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen (UKPV).
Im Jahr 1990 ging das bestehende PMO-Vermögen zur Prüfung und treuhänderischen Verwaltung in die Hände der Unabhängigen Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen (UKPV).
In verschiedenen Organisationen und Parteien versuchten Funktionäre jedoch, die Geldbestände am Gesetz vorbei nach Luxemburg, Liechtenstein und in die Schweiz zu transferieren. Dies gelang mit beträchtlichen Summen.
Die UKPV suchte nach der Wende nach diesem Vermögen und trug durch ihre – vor allem ermittelnde – Tätigkeit dazu bei, dass zwischen 1990 und 2006 Vermögenswerte in Höhe von mehr als 1,6 Milliarden Euro sichergestellt werden konnten. Diese wurden überwiegend für die Tilgung von Altschulden, für die Stiftung Aufarbeitung und für gemeinnützige Zwecke in den neuen Ländern verwendet (ca. 920 Millionen Euro).
Die restlichen Mittel (ca. 687,5 Millionen Euro) wurden für Abwicklungen der Parteien, Rentenfonds, Rückstellungen für Rechts- und Reprivatisierungsverfahren und Verwaltungskosten verwendet. Eine genaue Aufschlüsselung findet sich im Abschlussbericht der UKPV aus dem Jahr 2006. Nach dem Jahr 2006 übernahm die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) die noch offenen Rechtsstreitigkeiten.
In der Zeit nach 2006 gab es noch einige Entscheidungen bei den ausstehenden Gerichtsverfahren in der Schweiz, so dass bis zum Jahr 2019 weitere Vermögenswerte in Höhe von rund 400 Millionen Euro sicher gestellt wurden.
Verteilt wurde das Geld an die ostdeutschen Bundesländer nach einem festgelegten Schlüssel, der sich an der Einwohnerzahl vom 31. Dezember 1991 orientiert. Sachsen-Anhalt steht demnach 17,88 Prozent der Mittel zu, die für gemeinnützige Zwecke verwendet werden dürfen. Wie viel genau das zwischen 1990 und 2007 war, konnte ich nicht recherchieren. Aber das kann man ja mal bei der Landesregierung erfragen…
Die Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag stellt aber die Ausschüttungen ab dem Jahr 2008 dar. Demnach sind Sachsen-Anhalt zwischen 2008 und 2018 Mittel in Höhe von 77,7 Millionen Euro zugewiesen worden. Eine Kleine Anfrage der Grünen aus dem Jahr 2011 stellt dar, wofür die Mittel aus den Tranchen 2008, 2009 und 2010 verwendet wurden.
Eine meiner Kleinen Anfragen zeigt, wofür das Geld aus der letzten Tranche im Jahr 2018 konkret verwendet wurde. Im Jahr 2018 wurde uns im Finanzausschuss mitgeteilt, dass diese Tranche die letzte sei und nun alle Verfahren abgeschlossen wären.
Umso erstaunter war ich, als ich die 36 Millionen Euro im Einzelplan 13 für das Jahr 2020 entdeckte. Offenbar waren doch noch nicht alle Verfahren abgeschlossen und nach wie vor Geld im System. Wenn man sich den Ausgabetitel ansieht, wird deutlich, dass die 36 Millionen Euro in den kommenden Jahren für Digitalisierung, soziale Infrastruktur und kulturelle Einrichtungen ausgegeben werden sollen. Ich habe im Finanzministerium darum gebeten, uns die genauen Projekte aufzuschlüsseln und in den Haushaltsverhandlungen darzulegen. Die Verwendung für die Digitalisierung kommt mir merkwürdig vor und ist aus meiner Sicht nur schwer mit der vorgesehenen Zweckbindung vereinbar.
Übrigens finde ich es ganz allgemein schwierig, dass allein die Landesregierung über die Verwendung der Mittel entscheidet und der Haushaltsgesetzgeber (mal wieder) komplett außen vor gelassen wird….
23.01.2020 | Fachpolitik, Im Landtag
Stimmt…da war doch noch der Haushalt!
Nachdem in der Dezembersitzung des Landtages der Haushalt von der Landesregierung eingebracht und besprochen wurde, beschäftigen sich seit Anfang Januar Fachausschüsse mit dem Haushaltsgesetz und den Einzelplänen. Einzelpläne sind Zusammenstellungen der Einnahmen und Ausgaben jedes Ministeriums für ein oder zwei Jahre.
 Alle Fachausschüsse besprechen die für sie relevanten Einzelpläne in zwei Sitzungen und auch das Plenum befasst sich zwei Mal (Dezember und voraussichtlich März) mit dem Haushalt (daher dauert das Verfahren ungefähr drei Monate).
Alle Fachausschüsse besprechen die für sie relevanten Einzelpläne in zwei Sitzungen und auch das Plenum befasst sich zwei Mal (Dezember und voraussichtlich März) mit dem Haushalt (daher dauert das Verfahren ungefähr drei Monate).
Manche Einzelpläne werden nur im Finanzausschuss besprochen, weswegen das Verfahren dort deutlich einfacher und schneller verläuft. Das betrifft die Pläne für den Landtag, den Datenschutzbeauftragten, den Landesrechnungshof und das Finanzministerium. Drei davon haben wir in den vergangenen Tagen bereits behandelt.
Im Finanzausschuss geht es am 5. Februar weiter, bis Ende März sind zehn Sitzungen geplant, ob diese reichen werden, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.
Fakt ist, es gibt eine ganze Menge ungeklärter Probleme in dem Haushaltsentwurf der Regierung (Straßenausbaubeiträge, Schulsozialarbeit, Grunderwerbsteuer etc.). Beim Lesen sind uns noch weitere Lücken, Ungenauigkeiten und Schummeleien aufgefallen. Diese müssen auch thematisiert und erklärt werden. Aufgefallen ist uns auch, dass die Koalition sehr lustlos agiert. Die Fachausschusssitzungen waren durch die Fragen meiner Fraktion dominiert, hätten wir nichts gefragt, wären die Sitzungen teilweise nach 30 Minuten vorbei gewesen. Offenbar hat die Koalition vorher schon alles besprochen oder sie vertraut der Regierung blind. Mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass es so ruhig nicht bleiben wird…
14.01.2020 | Fachpolitik, Im Landtag
Wenn Abgeordnete in Kleinen Anfragen Sachverhalte hinterfragen, die nicht zur Veröffentlichung gedacht sind, werden die Antworten in die Geheimschutzstelle des Landtages geschickt. Dort kann man sich die delikaten Antworten unter Aufsicht anschauen, darf sie aber nicht mitnehmen oder veröffentlichen.
Einerseits ist diese Regelung durchaus nachvollziehbar, denn manche Informationen können persönliche Daten beinhalten (z.B. woher jemand stammt oder wieviel Geld die Person verdient). Andererseits ist die Landesregierung bei der Einschätzung von geheimschutzbedürftigen Informationen mitunter sehr streng, heißt, die Ministerien hinterlegen manchmal Daten, die aus meiner Sicht dort nicht hingehören.
Wie läuft das in der Geheimschutzstelle genau ab? Es gibt im Verwaltungstrakt des Landtages einen kleinen Geheimschutzraum. Dort bekommt man nur durch eine Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung Zugang und kann sich, nach Anmeldung, die geheimen Akten anschauen. In der Mitte des Raumes steht ein großer Beratungstisch und in der Ecke ein kleiner Tresor, in dem die Akten aufbewahrt werden. Am Ende des Tisches sitzt eine Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung und bewacht das Aktenstudium der Abgeordneten.
 Die Abgeordneten dürfen keine Kopien oder Fotos der Akten machen, dafür aber in bestimmten Fällen handschriftliche Notizen anfertigen. Man könnte also in stundenlanger Fleißarbeit die geheimen Antworten in ein Notizheft übertragen und hätte die Antworten dann doch. Das ist bei zwei- oder dreiseitigen Antworten durchaus möglich, bei Excel-Tabellen die sich über zwanzig Seiten erstrecken, kommt man an seine Grenzen.
Die Abgeordneten dürfen keine Kopien oder Fotos der Akten machen, dafür aber in bestimmten Fällen handschriftliche Notizen anfertigen. Man könnte also in stundenlanger Fleißarbeit die geheimen Antworten in ein Notizheft übertragen und hätte die Antworten dann doch. Das ist bei zwei- oder dreiseitigen Antworten durchaus möglich, bei Excel-Tabellen die sich über zwanzig Seiten erstrecken, kommt man an seine Grenzen.
Einsicht in die Antworten auf Kleine Anfragen dürfen alle Abgeordnete nehmen, egal wer sie gestellt hat. Ansonsten darf sie niemand einsehen. Man darf also keinen wissenschaftlichen Referenten dort hin setzen und auch nicht darüber reden, man kann keinen Juristen zu Rate ziehen oder den Landesrechnungshof fragen. Bei manchen Sachverhalten braucht man aber Experten, weil man die Sachverhalte nicht vollends versteht.
Hier sind die Waffen also sehr unfair verteilt. Auf der einen Seite die Exekutive und in gewisser Weise auch die Landtagsverwaltung mit einer Menge Fachwissen und einer sehr streng auslegbaren Geheimschutzordnung. Und auf der anderen Seite der/die einzelne Abgeordnete allein in der Geheimschutzstelle.
Fraglich ist auch, wer in den Ministerien eigentlich über die Einstufung der Geheimhaltung entscheidet. Das Kabinettreferat, das Ministerbüro, die Fachabteilungen? Und überprüft jemand die Sinnhaftigkeit dieser Einstufung? Offenbar nicht. Das führt dazu, dass es mitunter zu absurden Einstufungen kommt. Zur Veranschaulichung zwei Beispiele:
Die Kleine Anfrage zu Ostdeutschen in Führungspositionen in der Landesverwaltung ist zum Teil in der Geheimschutzstelle gelandet, z.B. die kompletten Daten der Staatskanzlei. Es ist also geheim, wie viele Abteilungsleiter und Referatsleiter in der Staatskanzlei aus dem Osten kommen. Alle anderen Ministerien haben ihre Daten offengelegt. Begründet wird das Verhalten der Staatskanzlei mit Datenschutz der relevanten ca. 45 Beschäftigten. Das ist an sich schon mal komisch, weil man bei der großen Zahl nicht erkennen kann, wer jeweils gemeint ist.
Noch komischer wird diese Einstufung, wenn man sich die Antwort auf die Kleine Anfrage zu Nebeneinkünften von Führungskräften an Universitätskliniken des Landes ansieht. Dort ist die Rede von einer Person in der Uniklinik Magdeburg, die diverse (auch konkret benannte Nebeneinkünfte hat). Ein Klick auf einer Suchmaschine und man weiß, um wen es sich handelt. Hier wird der Datenschutz offenbar nicht so groß geschrieben. Aus meiner Sicht hätte die Einstufung der beiden Antworten genau anders herum sein müssen: Offenlegung der Daten der Staatskanzlei, Schutz der Führungskraft der Uniklinik Magdeburg.
Ein zweites Beispiel ist der Umgang mit Informationen zu Studien, Gutachten und Beraterverträgen von Land und Unikliniken. Unsere diversen Anfragen ans Land wurden fast komplett veröffentlicht, eine Anfrage an die Unikliniken zum gleichen Thema ist zum Großteil in der Geheimschutzstelle gelandet. Warum? Die Unikliniken sind Anstalten öffentlichen Rechts und werden auch durch öffentliche Mittel finanziert.
Um sich gegen diese mitunter nicht nachvollziehbaren Sicherheitseinstufungen zu wehren, muss man die Geheimschutzordnung des Landtages und deren Lücken gut kennen. Außerdem hilft es, im Landtag oder bei den Ministerien nachzufragen und zu verhandeln, sich an die Präsidentin zu wenden, oder mit MinisterInnen persönlich zu sprechen. Das kostet aber viel Zeit und Kraft. Aus meiner Sicht ist die Geheimschutzordnung in der aktuellen Form nicht praktikabel und behindert die Arbeit der Abgeordneten, denn wie sollen wir Dinge ändern oder öffentlich hinterfragen, wenn wir nicht mal darüber reden dürfen?
10.01.2020 | Fachpolitik
Ein meist sehr angenehmer und fruchtbringender Termin Anfang des Jahres ist der Neujahrsempfang der Landesregierung in der Staatskanzlei. Dazu sind neben dem gesamten Kabinett und dem Parlament auch Bundes- und Kreispolitiker und diverse Lobbyvertreter eingeladen.
Traditionell hält der Ministerpräsident auf der großen Empfangstreppe stehend, gerahmt von seinen beiden Stellvertreterinnen, eine mehr oder weniger zündende Rede und dann darf gespeist, getrunken und erzählt werden.
In Erinnerung geblieben ist mir der Neujahrsempfang 2018, auf dem die damalige Bildungsstaatssekretärin erfuhr, dass sie entlassen wird und daraufhin überstürzt die Veranstaltung verließ. Es schwieg sich an dem Abend schnell herum, was passiert war und alle hatten ein gemeinsames Gesprächsthema.
In diesem Jahr gab es zwei Themen, die mir immer wieder begegneten: Die schwierige finanzielle Lage von Kreisen und Kommunen und der offenbar geplatzte Kauf des Burgenlandklinikums durch die Uniklinik Halle.
Einige Kommunen des Landkreises Mansfeld-Südharz hatten den Landkreis wegen der Kreisumlage verklagt und nun gewonnen. Der Landkreis muss rund 16 Millionen Euro (plus Zinsen) an die Kommunen zurück zahlen.
 Die Kreisumlage ist eine von den Kommunen zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Sie ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise und wird deshalb erhoben, weil Landkreise kaum nennenswerte eigene Steuereinnahmen erzielen.
Die Kreisumlage ist eine von den Kommunen zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Sie ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise und wird deshalb erhoben, weil Landkreise kaum nennenswerte eigene Steuereinnahmen erzielen.
Auch andere Kreise wurden von ihren Kommunen verklagt und es steht zu erwarten, dass eine juristische Erfolgswelle für die Kommunen heranrollt. Das Problem ist: Kein Landkreis kann die strittigen Summen aufbringen, also wird das Landkreisproblem plötzlich zu einem Landesproblem. Im Prozess in Mansfeld-Südharz wurde gesagt, dass das Land für einen großen Teil der Finanzprobleme des Kreises und der Kommunen verantwortlich sei, weil die finanzielle Ausstattung einfach nicht ausreichen würde. Diesen Vorwurf hören wir im Landtag schon seit Jahren immer wieder. Ich fürchte, wir werden das Problem der Kreise während der Haushaltsverhandlungen noch zusätzlich auf den Tisch bekommen.
Das zweite Thema ist ebenso aktuell: Die Uniklinik Halle hatte Interesse am Kauf des insolventen Burgenlandklinikums angemeldet. Ein Kauf durch die Uniklinik ist aber nicht so einfach ist, weil die Uniklinik dem Land gehört. Das bedeutet, dass das Land im Hintergrund haftet. Hier stoßen landespolitisch nun die Interessen dreier Ressorts aufeinander: Gesundheit (SPD) und Wissenschaft (SPD) und Finanzen (CDU).
Während die Gesundheitsministerin den Standort gern erhalten würde, sieht der Wissenschaftsminister durch einen Kauf zwar Forschungsmöglichkeiten für die Uniklinik, kennt aber sehr wohl die engen finanziellen Spielräume des Landes. Und dem Finanzminister ist der Prozess so lange egal, wie er kein Landesgeld kostet. Da das bei einem Kauf durch die Uniklinik der Fall wäre, ist er dagegen. Offenbar hat sich der Finanzminister nun durchgesetzt und einen Kauf des Burgenlandklinikums durch die öffentliche Hand verhindert. Am kommenden Dienstag soll das Kabinett darüber entscheiden.

Aus finanzieller Sicht ist das nachvollziehbar, denn der Haushalt ist noch nicht beschlossen und keiner weiß, woher die Uniklinik Halle über 100 Millionen Euro zum Erwerb des Klinikums nehmen soll. Aber wie sieht die Alternative aus? Private Krankenhausinvestoren scheinen sich momentan zu überbieten, offenbar sind die beiden Kliniken in Zeitz und Naumburg attraktiver als gedacht. Aber wollen die Menschen dort ein weiteres AMEOS-Klinikum, wo gerade dieser Träger im Land wegen seiner schlechten Personalpolitik sehr in der Kritik steht?
Dass mit kranken Menschen Geld verdient wird, halte ich grundsätzlich für falsch, daher empfinde ich auch eine Privatisierung des Klinikums als keine gute Lösung. Die beiden Standorte komplett zu schließen, ist aber auch keine Option. Ich fände einen gemeinnützigen Träger sinnvoll, aber ob sich dieser finden lässt? Auch dieses Thema, und ich fürchte, die ganze Situation der Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt, wird uns Finanzer in den nächsten Monaten und Jahren beschäftigen…
16.12.2019 | Fachpolitik, Im Landtag
Üblicherweise tagt der Landtag vor der Sommerpause und vor Weihnachten drei Tage lang. Diese Tage sind auch meist sehr gut gefüllt, da vor der Pause des Plenums noch einiges abgearbeitet werden muss.
In dieser Vor-Weihnachts-Woche tagen wir sogar vier Mal. Ursache dafür ist die Diskussion um die NORD/LB. Wir müssen in dieser Woche im Plenum den Staatsvertrag zur Rettung der Bank verabschieden, damit bis Ende des Jahres Geld fließen kann. Da zwischen der Einbringung des Gesetzes und der Verabschiedung zwei Tage liegen müssen, ist der Montag nun als weiterer Sitzungstag dazu gekommen.
Eingebacht wird außerdem der Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021. Da es sich um eine Generaldebatte handelt, bei der man mal über alles sprechen kann (weil der Haushalt ja alles umfasst), sind für den Haushalt rund fünf Stunden Diskussion eingeplant. Wenn dieser Kraftakt vorbei ist, wird der Haushalt dann ab Januar in den Ausschüssen behandelt.
Spannend werden außerdem die Debatten zum Gute-Kita-Gesetz, zur Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt und zur Causa Wendt. Zwischendrin bleibt hoffentlich noch etwas Zeit, Haushaltspläne zu lesen und die kommenden Verhandlungen vorzubereiten.
Ach und dann besteht ja nach wie vor die Möglichkeit, dass die Regierung wegen der Diskussion um das CDU-Mitglied Möritz und dessen rechtsextreme Vergangenheit platzt. Unter diesen Bedingungen lässt sich natürlich super über die Zukunft dieses Landes debattieren…
05.12.2019 | Fachpolitik, Unterwegs
In dieser Legislatur sind gefühlt ständig alle Abgerodneten auf Reisen. Ich habe bissher ein bisschen traurig hinterher geschaut. Irgendwas kam bei mir immer dazwischen: Haushalt, Ausschüsse, Wahlkreistermine.
Nun bietet sich auch mir eine Gelegenheit, meinen fachlichen Horizont im Ausland zu erweitern. Dadurch, dass die Haushaltsverhandlungen erst so spät im Jahr beginnen, kann ich vom 6. Dezember bis zum 12. Dezember an einer Fachkräftereise nach Israel teilnehmen. Das Pressenetzwerk für Jugendthemen (PNJ) hatte diese Reise im Oktober ausgeschrieben, bewerben konnte sich, wer einen Jugendverbandshintergrund und Presseerfahrungen hat. Das trifft beides auf mich zu.

Alles ein bisschen anders, aber vielleicht beispielgebend für die multikulturelle Jugendarbeit bei uns. Foto: pixabay
Thema der Reise ist “Jugendsozialarbeit in Israel”. Wir werden verschiedene Jugendzentren und Institutionen besuchen, uns mit dem freiwilligen Sozialdienst der israelischen Armee beschäftigen und uns ein Mehr-Generationen-Projekt anschauen.
Mich interessiert besonders der Aspekt der Jugendarbeit mit Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Durch die verstärkte Zuwanderung seit 2015 steht auch die Jugendhilfe in Sachsen-Anhalt vor einigen neuen Herausforderungen, gerade im Umgang mit jungen Menschen aus islamisch geprägten Ländern. Hier interessiert mich, wie man im multikulturellen Land Israel mit Problemen unterschiedlicher Ethnien umgeht. Die Reise führt uns unter anderem nach Haifa, Tel Aviv und Jerusalem.
Im Sinne der Transparenz möchte ich auch die Kosten der Reise offenlegen. Die Reise wird durch Teilnehmerbeiträge und Mittel des Bundes finanziert. Jeder Teilnehmer zahlt 485 Euro (Übernachtung und Frühstück) plus 150 Euro Kaution, die zurückerstattet wird, wenn ein journalistischer Beitrag über die Erlebnisse veröffentlicht wird. Dazu kommen noch Kosten für den Flug (323 Euro), die Fahrten zum Flughafen, Mittag- und Abendessen. Der Flug muss selbst gebucht werden, wird aber anschließend erstattet.
Ich freue mich sehr darüber, Israel zu besuchen und bin sehr gespannt auf die Menschen, Institutionen und Austauschmöglichkeiten.
 Im Jahr 1990 ging das bestehende PMO-Vermögen zur Prüfung und treuhänderischen Verwaltung in die Hände der Unabhängigen Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen (UKPV).
Im Jahr 1990 ging das bestehende PMO-Vermögen zur Prüfung und treuhänderischen Verwaltung in die Hände der Unabhängigen Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen (UKPV).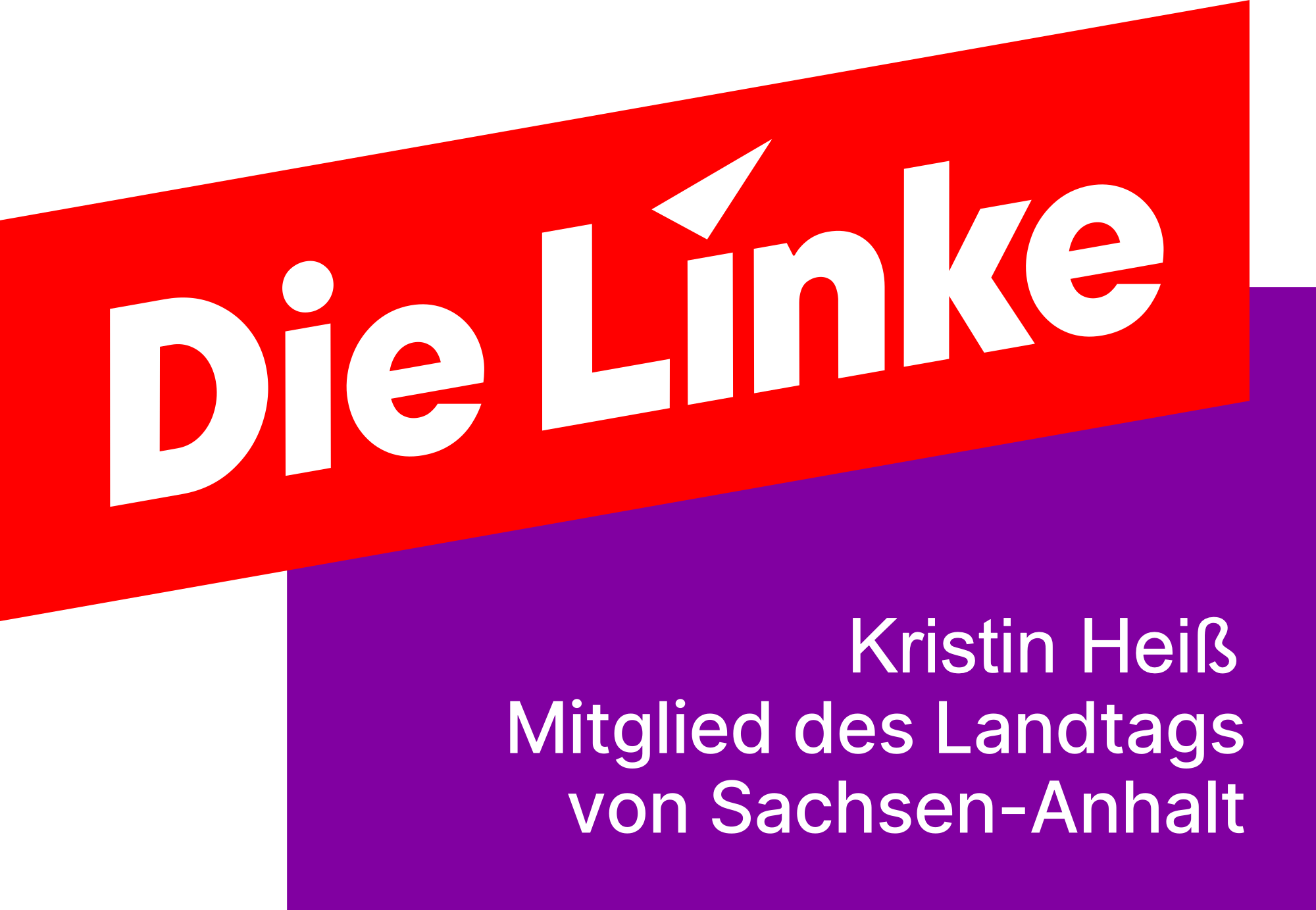
 Alle Fachausschüsse besprechen die für sie relevanten Einzelpläne in zwei Sitzungen und auch das Plenum befasst sich zwei Mal (Dezember und voraussichtlich März) mit dem Haushalt (daher dauert das Verfahren ungefähr drei Monate).
Alle Fachausschüsse besprechen die für sie relevanten Einzelpläne in zwei Sitzungen und auch das Plenum befasst sich zwei Mal (Dezember und voraussichtlich März) mit dem Haushalt (daher dauert das Verfahren ungefähr drei Monate). Die Abgeordneten dürfen keine Kopien oder Fotos der Akten machen, dafür aber in bestimmten Fällen handschriftliche Notizen anfertigen. Man könnte also in stundenlanger Fleißarbeit die geheimen Antworten in ein Notizheft übertragen und hätte die Antworten dann doch. Das ist bei zwei- oder dreiseitigen Antworten durchaus möglich, bei Excel-Tabellen die sich über zwanzig Seiten erstrecken, kommt man an seine Grenzen.
Die Abgeordneten dürfen keine Kopien oder Fotos der Akten machen, dafür aber in bestimmten Fällen handschriftliche Notizen anfertigen. Man könnte also in stundenlanger Fleißarbeit die geheimen Antworten in ein Notizheft übertragen und hätte die Antworten dann doch. Das ist bei zwei- oder dreiseitigen Antworten durchaus möglich, bei Excel-Tabellen die sich über zwanzig Seiten erstrecken, kommt man an seine Grenzen. Die Kreisumlage ist eine von den Kommunen zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Sie ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise und wird deshalb erhoben, weil Landkreise kaum nennenswerte eigene Steuereinnahmen erzielen.
Die Kreisumlage ist eine von den Kommunen zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Sie ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise und wird deshalb erhoben, weil Landkreise kaum nennenswerte eigene Steuereinnahmen erzielen.
